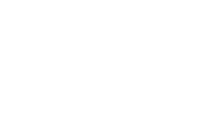„Zwischen Unsichtbarkeit, Repression und lesbischer Emanzipation – Frauenliebende* Frauen im deutschen Südwesten 1945 bis 1980er Jahre“
Kooperationsprojekt
Projektwebsite
Aktuelle Infos & Artikel unter "Lesbische* Lebenswelten im dt. Südwesten 1920-1970".
Veranstaltungen:
2025
Veranstaltungen für das neue Jahr folgen bald.
2024
- 9. Januar – 9. Februar: Ausstellung: "Ravensbrück, Zerbrochene Verbindungen im Heidelberger Rathaus" mit folgenden Veranstaltungen:
- 8. Januar: 20:00 Uhr Queer-feministischer Stammtisch mit Isabelle Sentis und dem Queeren Netzwerk Heidelberg.
- 9. Januar: 18:00 Uhr Ausstellungseröffnung „Zerbrochene Konstellationen, Ravensbrück“
Ort: Foyer des Rathauses | Marktplatz 10 | Heidelberg mit Isabelle Sentis. - 10. Januar: 17:00 Uhr Führung durch die Ausstellung „Constellations Brisées“ mit Isabelle Sentis
-
10. Januar: 19.30 Uhr Talk Hinter den Kulissen der Ausstellung „Zerbrochene Konstellationen, Ravensbrück“ mit Isabelle Sentis.
-
15. Januar: 19:00 Uhr Vortrag „Alleinstehende Frauen“, „Freundinnen“, „Frauenliebende Frauen“ – Lesbische Lebenswelten im deutschen Südwesten (ca. 1920er–1950er Jahre) mit Elena Mayeres, Muriel Lorenz, Steff Kunz.
-
19. Januar: 19:00 Uhr Dokumentarfilm mit Einführung und Diskussion: „Nelly & Nadine" mit Dr. Anna Hajkóvá.
-
24. Januar: 20:00 Uhr "Lesbische* Lebenswelten im deutschen Südwesten (1920-1950er Jahre)" im Rahmen der Web-Talk Reihe des Dokumentationszentrum Nationalsozialismus Freiburg mit Muriel Lorenz (M.A.) und Prof'in Dr. Sylvia Paletschek, Historisches Seminar der Universität Freiburg.
-
24. Januar: 19:00 Uhr Vortrag "Lesbische Jüdinnen im Nationalsozialismus: entrechtet, vertrieben, ermordet" mit Dr. Claudia Schoppmann .
-
07. Februar: 19:00 Uhr "Das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück: Geschlechtsnonkonformismus in der Häftlingsgesellschaft. Geschichte und Nachgeschichte" mit Dr. Insa Eschebach.
- 03. April: Präsentation des Booklets über „Lesbische* Lebenswelten im deutschen Südwesten“, Open Dykes Heidelberg , Karen Nolte, Katja Patzel-Mattern, Steff Kunz und Muriel Lorenz lesen.
- 22. April: Radiosendung Durchblick – bei Radio Flips: Muriel Lorenz, Steff Kunz, Elena Marie Mayeres vom Forschungsprojekt: Zwischen Unsichtbarkeit, Repression und lesbischer Emanzipation – Frauenliebende* Frauen im deutschen Südwesten (1945-1980er Jahre) mit Moderation von Helga Hedi Denu.
- 23. April: Vorstellung des Forschungsprojekts '“Alleinstehende Frauen”, “Freundinnen”, “frauenliebende Frauen” – Lesbische* Lebenswelten im deutschen Südwesten (ca. 1920er bis 1950er Jahre)' sowie Podiumsdiskussion zum Spannungsfeld von Wissenschaft und Aktivismus mit Karl-Heinz Steinle, Andrea Rottmann, Birgit Heidtke im Hotel Silber mit Ministerin Petra Olschowski.
- 23. April: SWR-Radiobeitrag "Kriminalisiert und benachteiligt: Erforschung lesbischer Geschichte im Südwesten" mit Prof.'in Dr. Sylvia Paletschek.
- 06. Mai: Queer Festival Heidelberg meets Forschungsprojekt “Frauenliebende* Frauen”, Kunstausstellung “Meret Eberl – NBSW” und Science Slam zu Queer und Gender Studies.
-
18. Juni: „Mädchen in Uniform" (1958) – ein lesbischer* Filmklassiker im zeithistorischen Kontext. Filmvorführung mit Einführung in Kooperation mi dem aka filmclub.
- 06. Dezember: "Von der (Un-)Sichtbarkeit lesbischer Liebe in den 1950er Jahren: Mädchen in Uniform (1958) im zeithistorischen Kontext" auf der Tagung "Das westdeutsche Kino der langen 1950er Jahre (1950-1963) jenseits von Mythen, Vorurteilen und Topoi", 5./6.12.2024 (Angers/online) mit Miriam Bräuer-Viereck.
- 13. Dezember: Kooperationsveranstaltung mit dem AKHFG Süd (Freiburg) mit Vorträgen von Corinne Rufli & Tobias Urech.
2023
- Juni-Juli: Filmvorführung und Moderation: "Mädchen in Uniform" und Fotoausstellung im Marstallcafé: "Mountain of A" von Margaret Liang im Rahmendes queer festivals Heidelberg.
- 06. Juni: 18.00 bis 20.00 Uhr "Queer Lives across the Wall: Desire and Danger in Divided Berlin, 1945–1970". Bericht über ein queerhistorisches Forschungsprojekt (in Kooperation mit den Gender Studies) von Dr. Andrea Rottmann (Berlin).
- 28. Juni: Vortrag Vortrag zu den Ergebnisse des ersten Projektzeitraumsim im Humpis Quartier, Ravensburg.
- 06. - 07. Juli: Netzwerktreffen Queere Zeitgeschichte in Berlin.
- 16. Oktober: Start des Hauptseminars „Zwischen Unsichtbarkeit, Repression und lesbischer Emanzipation – Frauenliebende Frauen im deutschen Südwesten 1945 bis 1980er Jahre und an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Leitung: Prof. Dr. Sylvia Paletschek, WS 2023/24).
- 20. Oktober: Vortrag in der Akademie für Ältere Heidelberg.
2022
- ab April: Veranstaltungsreihe des Forschungsprojekts „Lesben*geschichte – zwischen Unsichtbarkeit und Repression“. Die Veranstaltungsreihe wurde vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin in Zusammenarbeit mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg organisiert und war Teil des Queer Festival Heidelberg (https://queer-festival.de/).
- 25. April: Zwischen Anpassungsdruck und Zensur: Lesbische Liebe im 20. Jahrhundert von Kirsten Plötz:
- 05.Mai: "Zur Theorie der “Intersexualität” von Lesben in der Medizin der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Impulse für die Lesbengeschichte aus der Geschichte der Intergeschlechtlichkeit" von Ulrike Klöppel.
- 31. Mai: “Alleinstehende Frauen”, “Freundinnen”, “Frauenliebende Frauen” – Lesbische Lebenswelten im deutschen Südwesten (ca. 1920er-1970er Jahre) von Steff Kunz, Muriel Lorenz und Mirijam Schmidt.
- 08. Juni: Podiumsdiskussion ”Lesben*geschichtsforschung in der LGBTTIQ* Community und in der Universität.” mit Andrea Rottmann, Ilona Scheidle und Claudia Weinschenk. Moderation: Karen Nolte.
- 04. Juli: "Menschen ohne Geschichte sind Staub: Queere Jüd*innen im Holocaust" von Anna Hájková.
- 21. Juli: Podiumsdiskussion “Lesben* im Nationalsozialismus und Erinnerungspolitik - die Debatte um die GedenkkugeGesamtmodell zum Zusammenwirken von Depression, Medien und Suizidalitätl an die lesbischen Opfer des Nationalsozialismus im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück.” mit Wiebke Haß, Irmis Schwager und Martin Lücke. Moderation: Karen Nolte.
- 17. Mai: Internet Workshop zu den Begrifflichkeiten, Oral History und Konzeptionsfragen unter der Leitung von Kirsten Plötz.
- 31. Mai: Vortrag “Alleinstehende Frauen”, “Freundinnen”, “Frauenliebende Frauen” – Lesbische Lebenswelten im deutschen Südwesten (ca. 1920er-1970er Jahre) von Steff Kunz, Muriel Lorenz und Mirijam Schmidt in der Vortragsreihe "Lesben*geschichte - zwischen Unsichtbarkeit und Repression".
- 13. Juli: Vortrag “Lesbische“ Lebenswelten im deutschen Südwesten am Beispiel psychiatrischer Krankenakten – Zwischen Unsichtbarkeit und Sanktionierung” von Steff Kunz in: Digitale Studium-Universale-Ringvorlesung zum Thema „Sexualitäten und Geschlechter“ unter der Leitung von Dr. Richard Kühl, Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Universitätsklinikum Düsseldorf.
- 04. November: Vortrag "Eine nie endende Arbeit - 'Alleinerziehende' Mütter im Nationalsozialismus und der frühen BRD im Spiegel von Sorgerechts- und Fürsorgeakten in Baden und Württemberg" Mirijam Schmidt auf der 2. GLHA-Tagung: "Arbeit/Zeit. Umkämpfte Beziehungen und umstrittene Deutungen im 19. und 20. Jahrhundert".
- 16. Dezember: "Lesbische* Lebenswelten im deutschen Südwesten" – Projektbericht Muriel Lorenz im Rahmen des Arbeitskreis Historische Frauen- und Geschlechterforschung e.V. (AKHFG) Süd - Treffens.
2021
-
ab Oktober: Im Rahmen des Kolloquiums der Professur für Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg wurden Vorträge von Gastwissenschaftler*innen und Studierenden veranstaltet, die sich mit dem Themenbereich lesbische* Lebenswelten beschäftigten. Zudem bot sich den Studierenden dadurch die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten, die aus der Lehrveranstaltung zum Thema Lesbische Lebenswelten hervorgingen, in großer Runde zu diskutieren.
- 16. November: "Respektable Verhältnisse. Probleme der Deutung und Historisierung intimer Beziehungen in der deutschen Frauenbewegung um 1900." von Dr. Elisa Heinrich (Universität Wien).
- 07. Dezember: "Queere Geschichte*n Freiburg – Konzeptionierung, Umsetzung und Veröffentlichung eines lokalen Audioguides." von Lisa Okroi (Universität Freiburg).
- 10. Mai: "Alleinstehend, aber nicht allein? Die Darstellung von Lehrerinnen im Kontext nicht-heteronormativer Beziehungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts" (BA) von Ann-Kathrin Moritz.
- 17. Mai: "Lesbische Lebenswelten im Spiegel der Oral History. Drei Fallbeispiele der Jahrgänge 1935, 1944 und 1954 aus dem deutschen Südwesten" (BA) von Paula Foertsch.
- 17. Mai: "Anna E. Weirauchs „Der Skorpion“ – Eine Trilogie frauenliebender Frauen im Deutschland der 1920er und 1930er Jahre" (BA) von Jasmin Guhl.
- 14. Juni: "Von der Gefühlsgeschichte schwulen und lesbischen Lebens zur Diversifizierung der Zeitgeschichte" von Prof. Dr. Benno Gammerl (Europäisches Hochschulinstitut Florenz), (in Kooperation mit Kolloquium Eckel).
- 20. November: Vorstellung des Teilprojekts zur Medizingeschichte von Steff Kunz in: Südwestdeutsche Regionalkonferenz zur Medizin- und Wissenschaftsgeschichte („Brezelkonferenz“) unter Leitung von Dr. phil. Pierre Pfütsch.
Öffentlichkeitsarbeit
Publikationen
- Booklet über „Lesbische* Lebenswelten im deutschen Südwesten“, Open Dykes Heidelberg.
Berichterstattung
Neuigkeiten des Projekts auf
- Plattform X (ehem. Twitter): @LesbischeL
- BluySky: @LesbischeL
Sonstige Veröffentlichungen:
- Pressemitteilung der Universität Freiburg
- Artikel der Badischen Zeitung 'Historikerinnen forschen zu "Lesbischen Lebenswelten im Südwesten"'
- Artikel der Kontext-Wochenzeitung (taz-Beilage) 'Auf der Spur frauenliebender Frauen'
Projektbeschreibung
Laufzeit: 01.05.2023 - 30.04.2026
Die Geschichte weiblicher Homosexualität führt in der akademischen Forschung noch immer ein Schattendasein. Das gilt, obwohl in den letzten Jahrzehnten einschlägige Forschungsarbeiten entstanden sind – vielfach jenseits der Universitäten und Akademien. Vor allem im Vergleich zur Erforschung der Geschichte männlicher Homosexualität fällt die Randständigkeit auf.
Aber auch in der Frauen-, Geschlechter- und Sexualitätsgeschichte werden frauenliebende Frauen* und lesbisches* Begehren häufig ausgeblendet. So steht die historische Forschung bis heute vor großen Herausforderungen: Waren es zunächst Ressentiments und Repressionen gegenüber weiblicher Homosexualität, die die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema hemmten, so führten das Verschweigen und Verdrängen lesbischen* Lebens aus der Öffentlichkeit zu dem heute oft beklagten Quellenmangel. Aufgrund dessen ist über die Lebenssituation, die Diskriminierungen und Emanzipationsbestrebungen frauenliebender Frauen* bisher sehr wenig bekannt.
Ziel des gemeinschaftlichen Forschungsprojekts „Zwischen Unsichtbarkeit, Repression und lesbischer Emanzipation – Frauenliebende* Frauen im deutschen Südwesten 1945 bis 1980er Jahre“ ist es, Lebenswelten von frauenliebenden Frauen* außerhalb der großen Metropolen wie Berlin oder Hamburg zu erschließen. Es wird vom MWK Baden-Württemberg finanziert und ist an den Universitäten Heidelberg und Freiburg angesiedelt.
Ende 2022 wurde das Anforschungsprojekt, in dem die Forscher*innen die Ausgestaltung lesbischer* Lebenswelten in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus untersucht wurde, erfolgreich abgeschlossen. Am 01.05.2023 beginnt ein neuer Projektabschnitt, in dem die Nachkriegszeit bis in die 1980er Jahre, geografisch nach wie vor auf den deutschen Südwesten fokussiert, analysiert wird. Das Projekt verortet sich somit innerhalb der queeren Zeitgeschichte.
1. Akteurinnen – Vernetzungen – Kommunikationsräume
Ziel des Teilprojektes ist es, die politischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Leistungen und Errungenschaften frauenliebender*, nicht-heteronormativ lebender Frauen der 1950er- bis 1970er-Jahre sichtbar zu machen. Es wird untersucht, inwiefern die Nachkriegszeit als Umbruch für lesbische* Lebenswelten zu sehen ist: - Was änderte sich im gesellschaftlichen Alltag nach Kriegsende und bis Ende der 1970er Jahre für die Akteurinnen, Netzwerke und Kommunikationsräume im deutschen Südwesten? In welchen politischen und öffentlichen bzw. teilöffentlichen Arenen - wie z.B. Verbänden der Frauenbewegung, aber auch (Frauengruppen der) Parteien oder landespolitischen Gremien - konnten sich ‚klandestin’ frauenliebende* Frauen begegnen und verständigen?
Leitung: Prof. Dr. Sylvia Paletschek (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Historisches Seminar)
Mitarbeiter*in: Muriel Lorenz, M.A.
2. Die Grenzen des Privaten. Rechtliche und private Rahmenbedingungen
Wo verliefen die rechtlichen Grenzen des Privaten für lesbische* und nicht-heteronormativ lebende Frauen in Baden und Württemberg? Diese Frage hat das Teilprojekt im ersten Förderabschnitt für die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus u.a. mit Hilfe von Fürsorge- und Sorgerechtsakten erforscht. Dabei wurde erarbeitet, dass als sexuell deviant eingestuftes Verhalten außerhalb der Ehe zur Grundlage für die Bewertung einer Frau als „schlechte“ Mutter oder Tochter wurde und Auswirkungen auf die Gestaltung erzieherischer Interventionen durch Behörden oder bei einer Verurteilung das Strafmaß haben konnte. Auf diesen Ergebnissen aufbauend liegt im aktuellen Forschungsprojekt der Fokus auf frauenliebenden* und nicht-heteronormativ-lebenden Frauen, die in einer Mutter-Kind-Beziehung und/oder familiären Kontexten lebten und in Sorgerechts- oder Fürsorgestreitigkeiten verwickelt waren. Über die erprobte Herangehensweise hinausgehend werden nicht nur die Aktenbestände, sondern betroffene Mütter und Töchter in Oral History-Interviews befragt. Anhand dieser Quellen wird für die Nachkriegszeit bis in die 1980er Jahre zum einen nach Kontinuitäten in der Sorgerechts- und Fürsorgepraxis gefragt. Zum anderen werden sich verändernde Aneignungen und Gestaltungsmöglichkeiten untersucht.
Leitung: Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Historisches Seminar)
Mitarbeiter*in: Elena Mayeres, M.A.
3. Medizin- und wissenschaftsgeschichtliche Perspektive
Das Teilprojekt rekonstruiert, wie im Südwesten die Medizin, besonders die Psychiatrie, mit weiblicher Homosexualität im Untersuchungszeitraum umging. Aufbauend auf die im Anforschungsprojekt gesammelten Erkenntnisse, wird im neuen Projektabschnitt herausgearbeitet, ob und wann es nach 1945 zu einem Bruch im Umgang mit nicht heteronormativ lebenden Frauen in den psychiatrischen Einrichtungen kam. Wie haben sich Diagnosestellungen verändert? Wie wurde es aus psychiatrischer Sicht kategorisiert und eingeordnet? Welche moralischen Konnotationen von homoerotischen resp. eheähnlichen Beziehungen zwischen Frauen sind in den Niederschriften zu beobachten? Lässt sich die aus dem Anforschungsprojekt herausgearbeitete These verifizieren, dass Frauen, die homoerotische oder -sexuelle Beziehungen auslebten oder denen dies zugeschrieben wurde bzw. die als sexuell “triebhaft” beschrieben wurden, weit öfter weitere Anstaltsaufenthalte erlebten, als Frauen, die den geschlechtlichen und sexuellen Normen entsprachen? Um eine patientenorientierte Perspektive einzunehmen und so eine Geschichte „von unten“ zu schreiben, ist es unerlässlich die Stimmen von Zeitzeug*innen zu erheben, die uns für die Jahre nach dem Nationalsozialismus noch Auskunft geben können: Wie haben sie selbst die Situation und den Umgang mit frauenliebenden* Frauen in psychiatrischen Kontexten erlebt? Mit welchen therapeutischen Interventionen wurde ihnen begegnet? Diese Perspektive würde einen weiteren Aspekt des Themas beleuchten, so dass das Ziel der Sichtbarmachung lesbischer* Lebensweisen, besonders zu dieser Zeit, um ein weiteres Puzzleteil ergänzt werden kann.
Leitung: Prof. Dr. Karen Nolte (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Medizingeschichte)
Mitarbeiter*in: Steff Kunz, M.A.