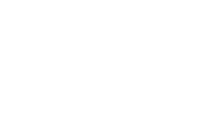Übung: Nation und Nationalbewußtsein in Deutschland vom Spätmittelalter bis zum frühen 19. Jahrhundert
Im politischen Sprachgebrauch der heutigen Bundesrepublik kommt der Begriff „Nation“ nicht mehr sehr häufig vor - eine Tatsache, die angesichts der Übersteigerung der nationalen Idee im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht verwunderlich ist. Dabei wird häufig übersehen, daß Sache und Begriff viel älter sind. Das Wort „natio“ stammt aus dem klassischen Latein und bedeutet „Geburt“ oder „Art“ bzw. „Gattung“; im Mittelalter diente es meist als Synonym für „gens“ (Stamm, Volk). Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde der Begriff auf die deutschsprachigen Teile des Reiches übertragen: Im Anschluß an das „Wiener Konkordat“ von 1448, abgeschlossen zwischen dem Papst und der „natio Alamanica“, artikulierten sich die „Gravamina der deutschen Nation“ gegen den römischen Hof, 1486 tauchte die Titulatur „Heiliges Römisches Reich deutscher Nation“ erstmals in einem Reichsgesetz auf. Dieser Prozeß erfuhr einen kräftigen Schub durch die Humanisten, die, vor allem in Abgrenzung zu den „Welschen“, ein deutsches Nationalbewußtsein schaffen wollten; konkret bedeutete dies vor allem die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte sowie die Erkundung des eigenen Landes. Ohne antirömische Polemik und nationalen Appell wäre auch die lutherische Reformation kaum zum Durchbruch gelangt. In der Folgezeit wurde der nationale Gedanke von der konfessionellen Spaltung und territorialen Zersplitterung des Reichs überlagert. Umso stärker trat er allerdings in Kriegszeiten in Erscheinung, so im Dreißigjährigen Krieg im Umfeld des Prager Friedens von 1635, als Reaktion auf die Eroberungskriege Ludwigs XIV. sowie im Siebenjährigen Krieg (1756-63), der neben einem Reichspatriotismus einen genuinen preußischen Patriotismus hervorbrachte. Integrierend wollten auch die Sprachgesellschaften wirken, die, beginnend mit der 1617 in Weimar gegründeten „Fruchtbringenden Gesellschaft“, das Ziel verfolgten, mittels Pflege der deutschen Sprache und Kultur das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Anknüpfend an die Vorstellungen Herders über den individuellen Volksgeist, setzte im Zeitalter Napoleons die Überhöhung der „Nation“, nunmehr verstanden als Nationalstaat, zu einem obersten Leitwert ein.
Die Übung ist als Quellenkurs konzipiert, bei Bedarf wird aber auch auf Forschungsliteratur zurückgegriffen. Zu Beginn erscheint es angebracht, sich einen Überblick über die verschiedenen Nationskonzepte zu verschaffen.
Zu erbringende Studienleistung
- Regelmäßige Teilnahme (max. 2 Fehlzeiten)
- Referat, Dauer ca. 15 Minuten
- Quelleninterpretation, Umfang ca. 5 Seiten
- schriftliche oder mündliche Ergebnissicherung, Dauer ca. 10 Minuten
Literatur
- Dieter Langewiesche/Georg Schmidt (Hg.), Föderative Nation. Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum Ersten Weltkrieg, München 2000.
- Georg Schmidt, Geschichte des Alten Reiches. Staat und Nation in der Frühen Neuzeit 1495-1806, München 1999.
- Joachim Ehlers (Hg.), Ansätze und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter, Sigmaringen 1989.